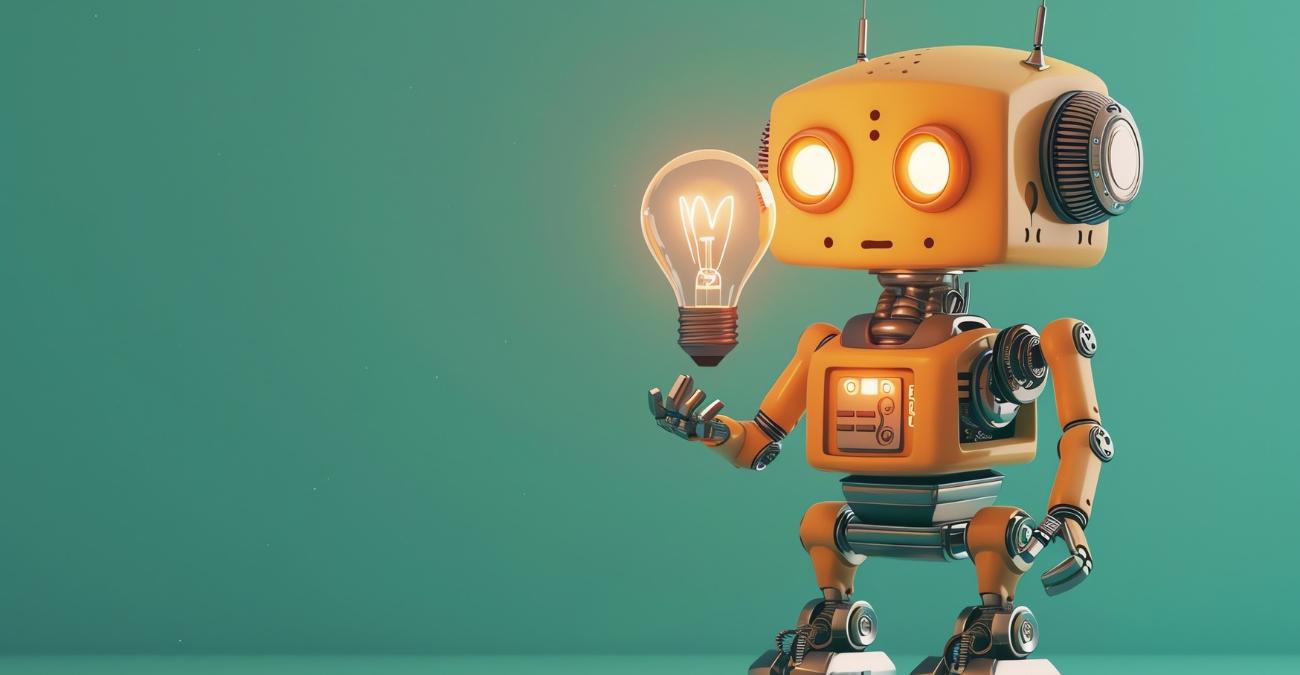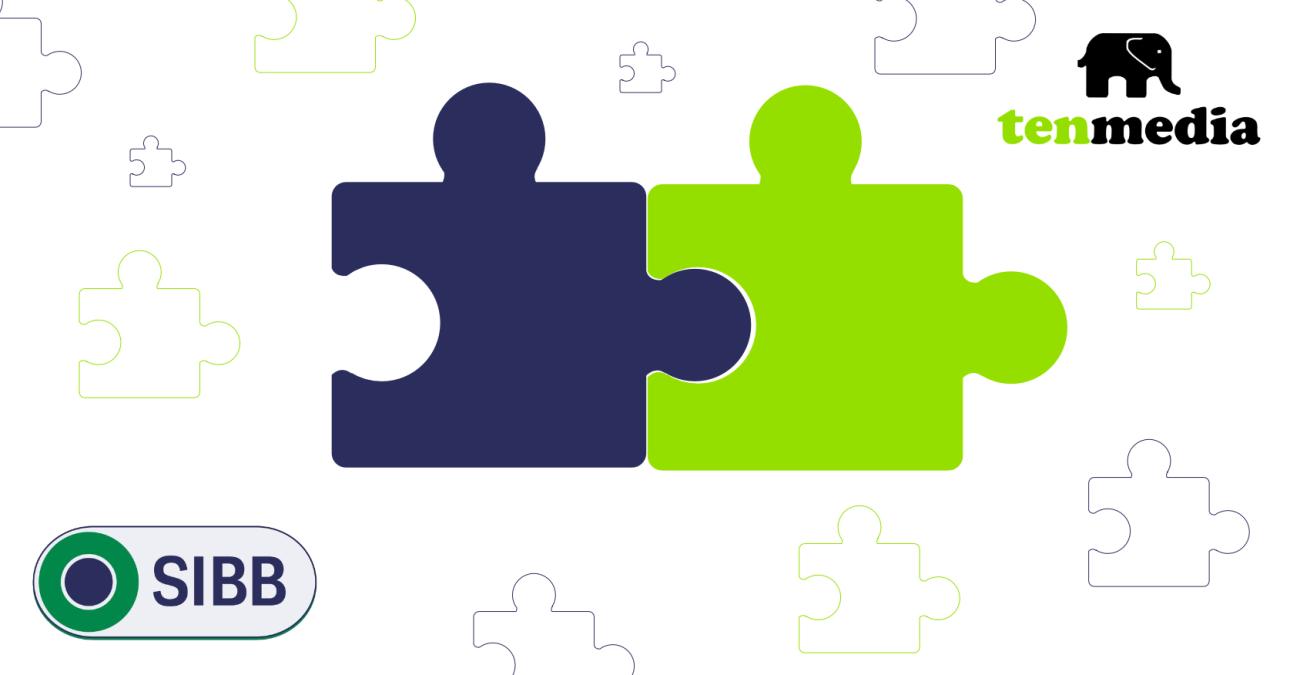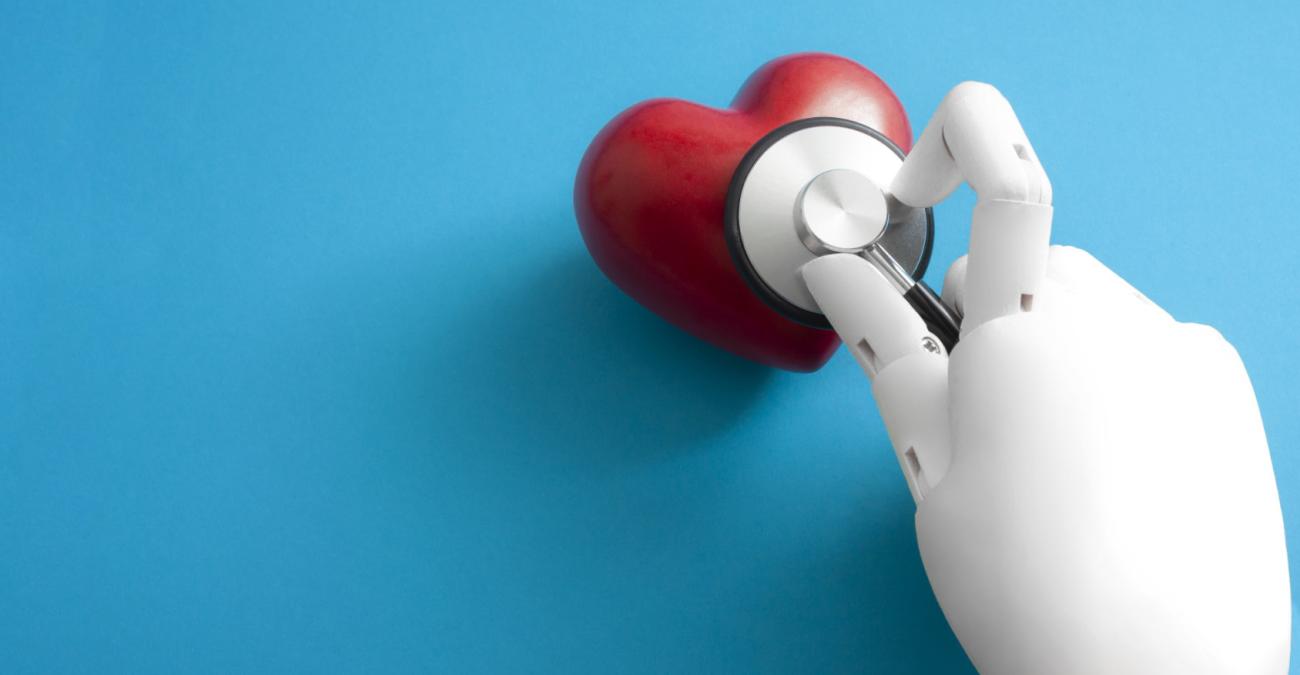Barrierefreie Software nach WCAG-Standard

- 1. Was bedeutet barrierefreie Software?
- 2. Welche Hilfsmittel unterstützen die Nutzung barrierefreier Software?
- 3. Für wen ist Barrierefreiheit Pflicht?
- 4. Was ist der Unterschied zwischen UX und Barrierefreiheit?
- 5. Welche Vorteile bietet barrierefreie Software für Unternehmen?
- 6. Was ist barrierefreie Softwareentwicklung?
- 7. Barrierefreie Software bei TenMedia entwickeln lassen
Als versierter IT-Dienstleister bieten wir von TenMedia Softwareentwicklung, Webentwicklung und Maintenance Support. Das beinhaltet auch die Betreuung und Neuentwicklung bestehender Software und Webseiten. Gern prüfen wir Software auf Barrierefreiheit und sorgen für ein rundum inklusives IT-System. Bei Interesse an unseren Angeboten freuen wir uns auf einen Anruf oder eine E-Mail.
Was bedeutet barrierefreie Software?
Die Barrierefreiheit von Software definiert die Gestaltung von Anwendungen in einer Weise, dass sie von allen Menschen – unabhängig von Behinderungen – uneingeschränkt genutzt werden können. Das umfasst barrierefreie Apps, Desktopprogramme und betriebssystemspezifische Software. Auch Webanwendungen zählen dazu. Ziel ist eine gleichberechtigte Teilhabe an der digitalen Welt.
Was bedeutet Barrierefreiheit in der IT?
In der IT steht Barrierefreiheit für barrierefreie Gestaltung von Informationstechnik gemäß verbindlicher Guidelines. Die bekanntesten Standards sind die WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sowie die deutsche BITV (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung). Ab dem 28. Juni 2025 erweitert das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) diese Anforderungen auch auf private Unternehmen, die dann ihre Software, Apps und digitalen Dienstleistungen barrierefrei gestalten müssen.
Barrierefreie Software vs. barrierefreie Webseiten
Während bisher vor allem Webseiten nach den Vorgaben der WCAG und BITV barrierefrei gestaltet werden mussten, bezieht sich das BFSG ausdrücklich auch auf Softwareprodukte und barrierefreie Apps. Barrierefreie Software berücksichtigt genauso wie barrierefreies Webdesign die Bedienung per Tastatur, Kompatibilität mit Screenreadern, visuelle Anpassungen und alternative Texte für Grafiken.
Welche technischen Standards gelten für barrierefreie Software?
Fachlicher Standard für die Umsetzung ist die jeweils gültige Version der WCAG, die weltweit angewendet wird. Im europäischen Kontext ist die Norm EN 301 549 maßgeblich – sie wurde in der deutschen BITV sowie im BFSG verankert. Diese europäische Norm legt technisch präzise Anforderungen an die Barrierefreiheit von Software, Webanwendungen und mobilen Apps fest und greift dabei Standards der internationalen ISO 9241-171 auf, die ergonomische Anforderungen an Softwareergonomie und Accessibility beschreibt.
Zur praktischen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben stehen umfangreiche Praxishilfen, Checklisten sowie technische Werkzeuge zur Verfügung.
Welche 4 Arten der Barrierefreiheit gibt es?
Um digitale Inhalte für alle Menschen zugänglich zu machen, werden in der Praxis üblicherweise vier grundlegende Arten der Barrierefreiheit unterschieden, die sich eng an den WCAG-Richtlinien orientieren. Diese Prinzipien sind essenziell für ein umfassendes barrierefreies Design.
- Wahrnehmbarkeit (Perceivable)
Dieses Prinzip stellt sicher, dass Informationen und Komponenten der Benutzeroberfläche so präsentiert werden, dass Nutzer sie wahrnehmen können. Dies bedeutet beispielsweise, dass Inhalte nicht nur visuell, sondern auch über andere Sinne (Hören, Tasten) zugänglich sein müssen. - Bedienbarkeit (Operable)
Im Fokus dieses Prinzips steht, dass die Komponenten der Benutzeroberfläche und die Navigation bedienbar sein müssen. Nutzern soll es möglich sein, die Oberfläche zu bedienen und zu interagieren. - Verständlichkeit (Understandable)
Dieses Prinzip fordert, dass Informationen und die Bedienung der Benutzeroberfläche verständlich sind. Dies umfasst die Verwendung von klarer Sprache, konsistenter Navigation und die Vermeidung von unnötiger Komplexität. Es soll sichergestellt werden, dass Nutzer die Funktionsweise der Software nachvollziehen können. - Robustheit (Robust)
Das vierte Prinzip besagt, dass Inhalte robust genug sein müssen, damit sie von einer großen Auswahl an Benutzeragenten, einschließlich assistierender Technologien (wie Screenreadern), zuverlässig interpretiert werden können. Dies erfordert eine saubere und standardkonforme technische Umsetzung, sodass die Software auch mit zukünftigen Technologien kompatibel bleibt.
Welche Hilfsmittel unterstützen die Nutzung barrierefreier Software?
Damit Menschen von der Barrierefreiheit in Software und Webanwendungen uneingeschränkt profitieren können, kommen verschiedene Hilfsmittel - sogenannte assistive Technologien - zum Einsatz.
Für Entwickler und Unternehmen stehen zahlreiche Praxishilfen, Handreichungen und Richtlinien wie die BITV oder die WCAG bereit, um Software und Webanwendungen barrierefrei zu entwickeln. Zentral dabei ist die Implementierung von Hilfsmitteln, den sogenannten assistiven Technologien. Die wichtigsten Praxishilfen für Menschen mit Einschränkungen sind folgende:
Screenreader und Screen Magnifier
Ein zentraler Baustein der Barrierefreiheit sind Screenreader. Sie übersetzen Inhalte, Navigationselemente und Strukturen auf dem Bildschirm in gesprochene Sprache oder auf Braillezeilen. Gerade blinde oder stark sehbehinderte Menschen profitieren hiervon. Ergänzend dazu bieten Screen Magnifier (Bildschirmvergrößerungssoftware) die Möglichkeit, Texte und Bedienelemente gezielt zu vergrößern und dadurch lesbarer zu machen.
Gebärdensprache und leichte Sprache
Im Bereich Audio gibt es ebenfalls vielfältige Unterstützung: Wer eine Hörbeeinträchtigung hat, kann durch Untertitel bei Videos und Audios oder auch durch Übersetzungen in Gebärdensprache Informationen direkt erfassen. Softwarelösungen sollten diese Funktionen standardmäßig unterstützen und bieten.
Damit Inhalte für alle verständlich bleiben, bieten moderne Anwendungen oft leichte Sprache als Alternative an. Dies erleichtert älteren Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geringeren Deutschkenntnissen das Verständnis.
Sprachsteuerung
Ein weiteres wesentliches Hilfsmittel ist die Sprachsteuerung. Menschen mit motorischen Einschränkungen können so Programme, Webanwendungen oder Cloud Services allein mit ihrer Stimme bedienen, ohne die Tastatur oder Maus zu nutzen. Alternativ kommen spezielle Eingabegeräte oder Tastaturlösungen zum Einsatz – beispielsweise Einhandtastaturen oder Schaltersteuerungen.
Kontrastmodi
Für viele Nutzer sind individuell anpassbare Kontrastmodi sowie anpassbare Farben unverzichtbar. Diese Optionen helfen besonders Menschen mit Sehbehinderungen oder Farbsehschwächen, digitale Inhalte besser wahrzunehmen.
Was ist ein Beispiel für Barrierefreiheit in Software?
Ein gutes Beispiel für barrierefreie Apps ist eine umfassend zugängliche Ticketbuchungsplattform für öffentliche Verkehrsmittel. Ihr Kernstück ist das barrierefreie Design.
Wenn ein sehbehinderter Nutzer eine Fahrkarte buchen möchte, ermöglicht die Software dies durch volle Unterstützung für Screenreader. Alle Schaltflächen, Felder und grafischen Elemente sind so programmiert, dass sie aussagekräftige Alternativtexte für die Sprachausgabe liefern. Die gesamte Anwendung lässt sich zudem ausschließlich über die Tastatur steuern, wodurch die Mausbedienung optional wird.
Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen bietet die Plattform die Option, komplexe Fahrplaninformationen in leichter Sprache darzustellen. Hörbehinderte Fahrgäste profitieren von integrierten Videos mit Untertiteln oder Übersetzungen in Gebärdensprache, die beispielsweise die Nutzung von Automaten oder bestimmte Tarifoptionen erklären.
Für wen ist Barrierefreiheit Pflicht?
Ab dem 28. Juni 2025 wird das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Deutschland wirksam. Es verpflichtet eine Vielzahl von Anbietern, digitale Softwareprodukte und -dienstleistungen barrierefrei zu stellen. Die Nichteinhaltung dieser Vorgaben kann Sanktionen nach sich ziehen. Daher ist die Barrierefreie Software eine Pflicht, die Unternehmen erfüllen sollten.
Anforderungen für barrierefreie Software laut BFSG beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche, darunter Betriebssysteme, Software für Selbstbedienungsterminals, E-Books, Smart-TVs und Anwendungen im Bankdienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben ist die Pflicht für Behörden, deren gesamte Software gemäß der BITV 2.0 den Barrierefreiheitsstandards entsprechen muss, um allen Menschen die digitale Teilhabe zu ermöglichen.
Im Bereich B2C (Business to Consumer) zielt das Gesetz auf eine umfassende Zugänglichkeit ab und betrifft unter anderem die Software hinter:
- Onlineshops und digitalen Verkaufsplattformen
- Buchungsportalen und Online-Kundenportalen
- Formularen und Apps für digitale Vertragsabschlüsse.
- Software, die Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten gewährt
Ausnahmen laut BSFG: Software, die nicht den Richtlinien und Standards entsprechen muss
Software, die Produkte lediglich präsentiert, der Kaufprozess aber über separate, nicht vom BFSG erfasste Kanäle abgewickelt wird, fällt nicht unter die Pflicht. Reine Informationssoftware und Blogs sind ebenfalls ausgenommen. Des Weiteren sind Intranet-Anwendungen, B2B-Software ohne Verbrauchervertragsfunktion sowie Software von Kleinstunternehmen (weniger als 10 Mitarbeiter, Jahresumsatz unter 2 Millionen Euro) befreit. Eine wichtige Ausnahme bilden jedoch Kleinstunternehmen, die Softwareprodukte vertreiben, die selbst unter das BFSG fallen.
Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung des BFSG für Software?
Die Einhaltung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) im Bereich barrierefreier Software wird von entsprechenden Stellen in den Behörden der Länder kontrolliert. Diese Behörden können sowohl proaktiv tätig werden als auch auf Beschwerden von Endverbrauchern oder anerkannten Verbänden reagieren.

Bei Verstößen gegen die Richtlinien für digitale Barrierefreiheit können erhebliche Konsequenzen drohen. Dazu zählen unter anderem Vertriebsverbote für die betreffende Software oder die Anordnung zur Einstellung der Dienstleistungserbringung. Zusätzlich können Geldbußen verhängt werden, die je nach Schwere des Verstoßes zwischen 10.000 und 100.000 Euro liegen können. Es ist entscheidend, dass Softwareanbieter die aktuellen Guidelines beachten, um die vollständige Compliance mit dem BFSG und der BITV zu gewährleisten.
Was ist der Unterschied zwischen UX und Barrierefreiheit?
Obwohl die Begriffe User Experience (UX) und Barrierefreiheit oft in einem Atemzug genannt werden, repräsentieren sie unterschiedliche Konzepte. Diese haben jedoch einige Schnittmengen.
UX als Grundlegender Baustein
UX konzentriert sich darauf, wie sich Nutzer fühlen, wenn sie ein Produkt oder eine Dienstleistung verwenden. Im Fokus stehen Effizienz, Zufriedenheit und Freude bei der Interaktion. Ein gutes UX-Design zielt darauf ab, eine intuitive Navigation und eine positive Gesamterfahrung für die Mehrheit der Anwender zu gestalten.
▼ Die Macht des UI/UX Designs – jetzt reinhören! ▼
Jetzt als Podcast hören!
Barrierefreies Design
Barrierefreiheit hingegen ist eine spezielle Facette der UX, die sich explizit darauf konzentriert, digitale Produkte und Dienste für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen. Ziel ist es, Hindernisse zu beseitigen, welche die Nutzung für bestimmte Personengruppen erschweren oder unmöglich machen könnten. Ein barrierefreies Design sorgt dafür, dass jeder, unabhängig von seinen Fähigkeiten, gleichberechtigt interagieren kann, was auch ein barrierefreies Arbeiten am Computer einschließt.
UX vs. Barrierefreiheit
- UX zielt auf allgemeine Benutzerfreundlichkeit ab.
- Barrierefreiheit ist ein Aspekt der UX mit Fokus auf Inklusion.
- UX kann subjektiv sein, Barrierefreiheit folgt klaren technischen Standards.
- Barrierefreiheit ist eine gesetzliche Anforderung (z.B. BFSG, BITV 2.0).
- Eine gute UX ist nicht automatisch barrierefrei.
- Barrierefreie digitale Produkte können die UX für alle User verbessern.
Welche Vorteile bietet barrierefreie Software für Unternehmen?
Ist eine Software barrierefrei, profitieren nicht nur Personen mit dauerhaften Beeinträchtigungen, sondern auch ältere Nutzer und Personen mit temporären Einschränkungen. Barrierefreies Design schafft eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit für alle.
Wettbewerbsvorteile durch barrierefreie Apps und Anwendungen
Über die reine Erfüllung gesetzlicher Richtlinien nach BFSG und BITV hinaus, bietet die Implementierung barrierefreier Software Solutions erhebliche Wettbewerbsvorteile. Die technische Integration von Barrierefreiheit – beispielsweise die Gewährleistung, dass das gesamte Netzwerk barrierefrei ist – verbessert nicht nur die Zugänglichkeit. Sie optimiert zusätzlich die User Experience für die gesamte Nutzerbasis.
Unternehmen, die in barrierefreie Software investieren, erschließen neue Marktsegmente. Menschen mit Behinderungen stellen eine erhebliche Zielgruppe dar, ergänzt durch eine stetig wachsende Anzahl älterer Menschen, die aktiv am digitalen Leben teilnehmen. Dies führt zu:
- Erhöhter Kundenzufriedenheit und -loyalität
Nutzer, die sich abgeholt und gleichberechtigt fühlen, entwickeln eine stärkere Bindung an Produkte und Marken. - Positivem Unternehmensimage
Die Übernahme sozialer Verantwortung stärkt die Glaubwürdigkeit und Attraktivität eines Unternehmens gegenüber Kunden, Partnern und potenziellen Mitarbeitern. - Rechtssicherheit
Die frühzeitige Anpassung an aktuelle Richtlinien minimiert das Risiko juristischer und finanzieller Konsequenzen.
Barrierefreiheit von Software für den Mittelstand als Erfolgsfaktor
Gerade Barrierefreiheit von Software für den Mittelstand bietet eine herausragende Chance zur Differenzierung. Während größere Konzerne oft schwerfällig auf neue Anforderungen reagieren, kann der Mittelstand durch agile Prozesse und gezielte Investitionen in barrierefreie Softwareentwicklung einen entscheidenden Vorsprung erzielen. Ein barrierefreies Arbeiten am Computer im eigenen Arbeitsplatz trägt zudem zur Inklusion im Unternehmen bei und verbessert die Mitarbeiterzufriedenheit.
Wie kann mein Unternehmen die Barrierefreiheit seiner IT sicherstellen?
Zukunftsorientierte Unternehmen verankern Barrierefreiheit nicht als bloße Pflichtübung, sondern als strategisches Alleinstellungsmerkmal und Innovationstreiber. Mit der Einhaltung der aktuellen BITV und weiterer Standards signalisieren sie gesellschaftliche Verantwortung und öffnen neue Märkte. Unterstützt wird dies auch durch Auszeichnungen wie den Bundesteilhabepreis, der innovative Praxisbeispiele sichtbarer macht und zum Nachahmen motiviert.
Kompetenzaufbau und Sensibilisierung als kontinuierlicher Prozess
Um Barrierefreiheit ganzheitlich umzusetzen, sind gezielte Schulungen und Sensibilisierung notwendig – nicht nur für Entwickler, sondern auch für Design- und Supportteams. Von Praxishilfen für barrierefreie Gestaltung über die Vermittlung von Fachwissen zu Screenreadern, Tastaturnavigation oder Leichter Sprache profitieren Mitarbeitende und letztlich alle Nutzer. Die Integration von Barrierefreiheit zu Beginn jedes Projektes ermöglicht es, Hürden frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
Barrierefreiheit von der Konzeption bis zum Praxistest
Inklusion beginnt bei der Anforderungsanalyse – durch frühzeitige Einbindung betroffener Menschen werden spezifische Bedarfe erfasst. Während der Entwicklung sorgen barrierefreie Programmiertechniken und die Nutzung von FAQ sowie Praxishilfen für einen reibungslosen Prozess.
Die Qualitätssicherung setzt sowohl auf automatisierte Prüfungen als auch auf manuelle Tests und Einbeziehung von Menschen mit Behinderung im. Nur mit echtem Feedback gelingt nachhaltige Verbesserung.
Spezialisierte Agenturen bieten Unterstützung bei Zertifizierungsprozessen, Assessments oder der Erstellung barrierefreier Webanwendungen. Mit aktuellen Praxishilfen und regelmäßig aktualisierten FAQ bleibt das eigene Team auf dem neuesten Stand.
Was ist barrierefreie Softwareentwicklung?
Barrierefreie Softwareentwicklung ist ein ganzheitlicher Ansatz, der die Prinzipien der Barrierefreiheit von den frühesten Phasen der Software-Entwicklung an integriert. Der Prozess beginnt mit einer gründlichen Analyse der Anforderungen und Vorgaben, die über die rein funktionalen Aspekte hinausgehen. Hierbei ist spezifisches Fachwissen über die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzergruppen (größtenteils Menschen mit Behinderungen) unerlässlich.
Während der Konzeptionsphase werden barrierefreie Formulare, intuitive Navigation und zugängliche Interaktionselemente von Grund auf geplant. Dies schließt die Strukturierung von Informationen und die Gestaltung von Benutzeroberflächen ein, um Kompatibilität mit assistiven Technologien zu gewährleisten.
In der Umsetzung werden konkrete Techniken angewendet. Dies beinhaltet die korrekte Implementierung von ARIA-Attributen (Accessible Rich Internet Applications), die Sicherstellung ausreichender Farbkontraste und die Bereitstellung von Textalternativen für alle visuellen Inhalte. Auch bei der Entwicklung von barrierefreien Apps für mobile Endgeräte werden diese Prinzipien konsequent angewandt, um Touch-Gesten und systemeigene Barrierefreiheitsfunktionen optimal zu nutzen.
Testing von barrierefreier Software
Regelmäßige Tests mit Nutzern und speziellen Tools begleiten den gesamten Prozess, um potenzielle Barrieren frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Ziel ist es, behindertengerechte Software zu stellen, die nicht nur den gesetzlichen Normen wie dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz entspricht, sondern auch eine optimale Benutzerfreundlichkeit für alle bietet.
Wie können bestehende Softwarelösungen barrierefrei gemacht werden?
Die Umgestaltung bestehender Software (Reverse Engineering) beginnt typischerweise mit einer umfassenden Prüfung auf bereits vorhandene Barrierefreiheit. Dabei werden spezifische Schwachstellen und Konformitätslücken identifiziert.
Die darauffolgende Softwareentwicklung für die Nachrüstung erfordert spezialisiertes Fachwissen. Es ist oft notwendig, Benutzeroberflächen neu zu konzipieren, um die Gestaltung inklusiver zu machen. Die Implementierung von Funktionen, die beispielsweise Informationen in leichte Sprache übersetzen oder eine konsistente, logische Navigation ermöglichen, sind zentrale Aspekte.
Stellen Lizenzrechte ein Problem dar?
Egal, ob eine Software aufgrund der Anpassung von Arbeitsprozessen optimiert oder barrierefrei gemacht werden soll: Auf jeden Fall müssen die Lizenzbedingungen beachtet werden. Diese sind bei proprietärer Software in der Regel sehr strikt. Reverse Engineering ist hier ausgeschlossen. Für Individualsoftware, die vom Unternehmen selbst entwickelt wurde, gilt dies nicht. Wurde eine Anwendung von einer Softwareagentur im Kundenauftrag entwickelt, erhält der Kunde zumeist auch die Rechte am Quellcode. Wer sich darüber nicht sicher ist, sollte den Support der Agentur kontaktieren.
Eine Ausnahme bildet oft auch Open Source Software, die beliebig angepasst werden kann. Allerdings gibt es in diesem Bereich diverse Richtlinien. Auch hier ist das Einholen konkreter Informationen vom Anbieter oder Entwickler der Software angebracht.
Outsourcing der Barrierefreiheit für Software
Unternehmen können auch professionell barrierefreie Software entwickeln lassen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes und der BITV 2.0 sicherzustellen. Externe Dienstleister bieten hierfür oft wertvolle Praxishilfen und das notwendige Know-how.
Die Implementierung barrierefreier Standards nach WCAG umfasst zum Beispiel:
- Detaillierte Barrierefreiheitsprüfung
Umfassende Analyse der bestehenden Software - Analyse der Nutzerbedürfnisse
Verstehen der Anforderungen unterschiedlicher Nutzergruppen - Priorisierung der Anpassungen
Festlegen der wichtigsten Umsetzungsbereiche - Neukonzeption von UI-Komponenten
Umfassende Überarbeitung relevanter Oberflächenelemente - Integration leichter Sprache
Implementierung von Optionen zur Inhaltsvereinfachung - Anpassung der Interaktionsmuster
Optimierung der Bedienung für alle Nutzer - Regelmäßige interne Tests
Überprüfung der Fortschritte während der Entwicklung - Nutzertests mit Menschen mit Behinderungen
Validierung der tatsächlichen Zugänglichkeit - Dokumentation der Barrierefreiheit
Erstellung einer Erklärung zur Barrierefreiheit
Barrierefreie Software bei TenMedia entwickeln lassen
Durch das Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes wird digitale Barrierefreiheit zu einem Must-have moderner Unternehmen und Behörden. Wir von TenMedia unterstützen Organisationen umfassend dabei, ihre digitalen Präsenzen den Richtlinien der WCAG anzupassen. Unsere Expertise ermöglicht es uns, Software und Webanwendungen barrierefrei zu gestalten. Egal, ob wir von Grund auf neue, barrierefreie Apps entwickeln oder bestehende Systeme überarbeiten: Unser Fokus liegt stets auf der Benutzerfreundlichkeit. Wir bieten konkrete Praxishilfen – beispielsweise durch die Verwendung von leichter Sprache, die Implementierung von Alt-Texten oder die Optimierung für Hilfstechnologien wie Screenreader.
Unser Service endet nicht mit der Entwicklung. Mit unserem umfassenden Maintenance-Support sorgen wir dafür, dass die Barrierefreiheit unserer Software. Dazu gehört Echtzeit-Monitoring, schnelle Störungsbehebung und flexible Wartungsverträge. Mit TenMedia steht für effiziente, nutzerorientiert und barrierefreie Software.